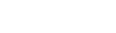Frau Luttenberger, in Ihrer Studie zum Thema "Klettern und Stimmung" zeigen erste Ergebnisse, dass sich der Gemütszustand depressiver Patienten während eines achtwöchigen Boulderkurses verbessert. Wie hat die Studie ausgesehen?
Zuerst haben wir Patienten angesprochen, die an einer Depression leiden. Einer Hälfte der Patienten haben wir mit unseren Bouldertherapeuten sofort die Therapie angeboten. Die andere Hälfte hat acht Wochen gewartet bevor die Therapie angefangen hat. Wir haben alle Patienten vorher und nachher untersucht und können somit vergleichen, was in den acht Wochen passiert ist: Geht es denen, die die Bouldertherapie gemacht haben, besser als den Teilnehmern der anderen Gruppe? Dies Frage könne wir bejahen.
Bouldertherapeut - was heißt das genau?
Um eine Bouldertherapie leiten zu können, muss man sowohl Erfahrung im Umgang mit dem Krankheitsbild als auch mit dem Klettern oder Bouldern haben - unsere Therapeuten sind Fachkrankenpfleger für Psychiatrie und seit vielen Jahren aktiv im Klettersport und haben dort verschiedene Fortbildungen.
Sport ist bei Depressionen hilfreich, auch Laufen oder Schwimmen. Warum wollten Sie gerade die Auswirkungen auf die Psyche depressiver Menschen beim Bouldern untersuchen?
Die Bouldertherapie hat aus unserer Sicht einige Vorteile: Beim Laufen sehen die Patienten beispielsweise nicht so schnell Erfolge. Das ist beim Bouldern anders: Patienten unterschiedlicher Fitnessniveaus können in der Halle zusammen bouldern und schnell besser werden.
Aber wenn ein Patient eine Route immer wieder versucht und daran scheitert, fühlt er sich dann nicht schlecht?
Dieses Leistungsdenken ist typisch für die Depression. Deshalb kann es durchaus vorkommen, dass jemand so reagiert. Es geht uns auch nicht darum, diese Symptome zu vermeiden, sondern mit ihnen zu arbeiten. Das heißt, wenn jemand sagt: "Naja, die Route habe ich nur durch die Hilfe anderer geschafft", dann können wir diese Interpretation hinterfragen und auch auf den Alltag übertragen. Beim Bouldern wird es sehr deutlich, dass der Patient oder die Patientin die Route allein geschafft haben - niemand hat sie hochgetragen.
Also nehmen die Patienten die Erfolge beim Bouldern eher wahr?
Genau, plötzlich haben sie eine Route geschafft, die sie das letzte Mal nicht geschafft haben. Das lässt sich dann nicht wegdiskutieren. Darum geht es in der Therapie: Mechanismen des Denkens sollen aufgelöst werden, bei denen die Patienten denken, sie schaffen nichts. Es geht nicht um Leistung sondern darum, Bouldern als ein therapeutisches Medium zu nutzen.
Warum haben Sie sich in ihrer Studie für das Bouldern und nicht das Klettern entschieden?
Anders als beim Klettern haben wir beim Bouldern viel kürzere Routen. Man kann schneller eine Route schaffen und Erfolg haben.
In Ihrer Bouldertherapie werden auch Achtsamkeitsübungen angewandt. Was sind das für Übungen?
Achtsamkeitsübungen sind vergleichbar mit Meditationsübungen: Zum Beispiel auf den eigenen Atem achten. Das dient dazu, dass man im Hier und Jetzt ankommt. Im Alltag ist man mit den Gedanken überall, nur nicht in der Gegenwart. Besonders depressive Menschen grübeln viel, das ist ein Hauptsymptom.
Und beim Bouldern kommen die Patienten auch im Hier und Jetzt an?
Genau, wenn ich an der Wand hänge, dann kann ich gar nicht an etwas anderes denken. Der Patient muss sich auf einen Boulder, auf den nächsten Zug konzentrieren. So wie bei den Achtsamkeitsübungen. Und da sehen wir auch den Unterschied zu den anderen Sportarten: Grübelschleifen werden durchbrochen, weil der Patient sich beim Bouldern so konzentriert.
Dann profitieren nicht-depressive Kletterer und Boulderer auch von den Auswirkungen?
Ich glaube, dass viele Kletterer oder Boulderer diesen Effekt schätzen. Nach dem Bouldern ist mein Kopf leer und ich kann besser schlafen. Ich habe von vielen nicht-depressiven Boulderern oder Kletterern gehört, dass es ihnen ähnlich geht. Und wir glauben, dass wir mit der Studie eine Therapie erschließen könnten, die für viele hilfreich sein kann.
Interview: Rabea Zühlke